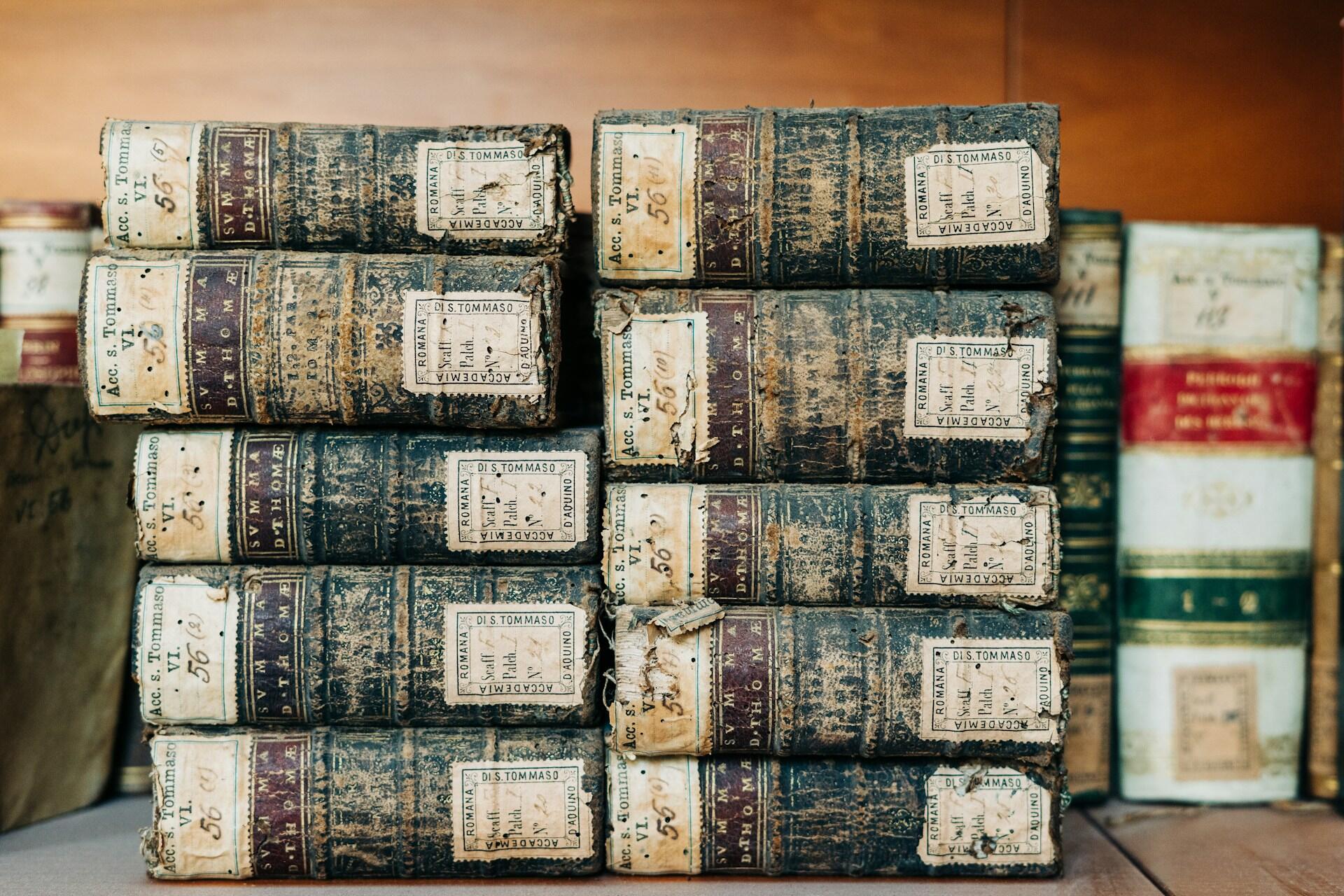Der Accusativus cum Infinitivo – kurz AcI – ist eine typische satzwertige Konstruktion im Lateinischen, die häufig nach Verben des Sagens, Denkens oder Wahrnehmens steht. Statt einen Nebensatz zu bilden, drückt das Latein mit dem AcI aus, was jemand sagt, glaubt oder empfindet – knapp und ohne Konjunktion.
In diesem Artikel erfährst du, was genau der AcI ist, wie du ihn erkennst, richtig übersetzt und welche Verben oder Pronomen dabei oft verwendet werden. Und auch das Zeitverhältnis nehmen wir unter die Lupe.

AcI Latein: Was ist das?
Der Accusativus cum Infinitivo (AcI) ist eine wichtige Infinitivkonstruktion im Lateinischen. Sie besteht aus einem Akkusativ als logisches Subjekt und einem Infinitiv als Prädikat. Diese Konstruktion tritt häufig nach Verben wie sehen, hören, wissen, sagen, glauben oder meinen auf. Ein AcI ersetzt im Deutschen inhaltlich einen dass-Satz.
Um ein Beispiel zu nennen: "Scio Corneliam venire." heißt übersetzt so viel wie "Ich weiß, dass Cornelia kommt".
Wörtlich übersetzen kann man den AcI meist nicht – im Deutschen braucht man also einen Nebensatz. Obwohl es auch im Deutschen AcI-ähnliche Strukturen gibt (z.B. "Ich sehe ihn gehen"), ist der Gebrauch in Lateinisch viel verbreiteter. Deshalb ist es wichtig, den AcI als satzwerte Konstruktion zu erkennen und sinnvoll zu übersetzen.
Der AcI ist eine lateinische Satzkonstruktion aus einem Akkusativ und einem Infinitiv, die meist einen dass-Satz ersetzt.
Wie kann ich einen AcI in Latein erkennen?
Einen AcI zu erkennen ist gar nicht so schwer, wenn du weißt, worauf du achten musst. Er besteht immer aus drei Teilen: einem Nomen im Akkusativ, einem Verb im Infinitiv und einem konjugierten Verb im übergeordneten Satz. Hier ein Beispiel:
Gustav gaudet [Corneliam venire].
→ Gustav freut sich, dass Cornelia kommt.
Das übergeordnete Verb ist dabei der Schlüssel. Es ist fast immer ein sogenanntes Kopfverb und beschreibt also etwas, das mit Sprechen, Denken, Wahrnehmen oder Fühlen zu tun hat. Beispiele für solche Kopfverben sind:
- dicere, nuntiare, respondere (sagen, berichten, antworten)
- scire, cogitare, intellegere (wissen, denken, verstehen)
- putare, iudicare, reri (meinen, urteilen, glauben)
- videre, audire, sentire (sehen, hören, fühlen)
- amare, dolere, gaudere (lieben, traurig sein, sich freuen)
Wenn du also eines dieser Verben in einem Satz findest, lohnt sich ein genauer Blick. Denn oft folgt dann ein AcI.
AcI übersetzten: So funktioniert's
Der AcI ist wie das PC eine satzwertige Konstruktion im Lateinischen. Das bedeutet: Auch wenn du auf Latein nur einen Satz siehst, brauchst du im Deutschen oft einen ganzen Nebensatz, um den Sinn richtig wiederzugeben. Am besten lässt sich der AcI mit einem dass-Satz übersetzen. Zum Beispiel:
Marcus videt [Corneliam ad forum currere].
→ Marcus sieht, dass Cornelia zum Forum läuft.
Dabei wird der Akkusativ (Corneliam) im Deutschen zum Nominativ (Cornelia), und der Infinitiv (currere) wird zu einem konjugierten Verb (läuft). So entsteht ein richtiger deutscher Nebensatz. Menschmal kannst du aber auch eine wortgenaue Übersetzung verwenden, etwa "Marcus sieht Cornelia zum Forum laufen".
So funktioniert das aber nur, wenn der Satz auch im Deutschen sinnvoll klingt. In vielen Fällen geht das nicht. Zum Beispiel:
Caesar periculum imminere scit.
→ Caesar weiß, dass eine Gefahr droht.
("Caesar weiß eine Gefahr drohen" wäre falsch!)
Unser Tipp: Übersetze den AcI immer zuerst mit einem dass-Satz. Das ist sicher, klar und meist die beste Wahl. Achte beim Übersetzen darauf, den Infinitiv richtig zu beugen und den Akkusativ zum Subjekt zu machen. Dann klappt's garantiert!

Häufige Verben im AcI
Auf Latein begegnet dir der AcI – wie wir bereits wissen – vor allem nach bestimmten Verben, den sogenannten Kopfverben. Diese Verben drücken aus, was jemand sagt, denkt, wahrnimmt oder fühlt. Du musst nicht alle auswendig lernen, aber es hilft, typische Gruppen zu kennen. Dazu gehören Verben des Sagens, zum Beispiel divere, nuntiare oder narrare.
Weiter geht's Wahrnehmungsverben wie videre, audire oder sentire. Dazu kommen Verben des Denkens – cogitare, intellegere, scire – und Verben des Meinens: putare, existimare oder iudicare. Auch Gefühlsverben wie gaudere, dolere oder mirari leiten gerne einen AcI ein. Und nicht zu vergesssen: Unpersönliche Ausdrücke wie constat ("es steht fest") oder oportet ("es ist nötig"). Es gilt beim Übersetzen also auf solche Verben zu achten. Sie sind ein klarer Hinweis auf einen AcI.
Erfahre, was sich hinter dem Ablativus Absolutus verbirgt.
Pronomen im AcI
Im AcI begegnen dir sehr häufig Pronomen – besonders als Subjektakkusativ. Dabei musst du genau hinschauen, um richtig zu übersetzen. Besonders wichtig ist das Reflexivpronomen (me, te, se, nos, vos). Es zeigt dir, dass sich das Subjekt im dass-Satz auf das Subjekt des Hauptsatzes bezieht. Zum Beispiel:
Marcus se Cornaliam amare putat.
→ Marcus glaubt, dass er Cornelia liebt.
Hier steht "se" im Akkusativ, wird im Deutschen aber als Subjekt mit er übersetzt. Corneliam bleibt im Akkusativ, da sie das Objekt des AcI ist. Achte darauf: Auch andere Akkusativformen im AcI müssen nicht automatisch das Subjekt sein. Es können zusätzliche Akkusativobjekte auftreten.
Wenn im AcI ein Pronomen wie eum, eam, eos oder eas steht, bezieht es sich meist auf eine andere Person als das Subjekt des Hauptsatzes. Um unser Beispiel fortzuführen:
Marcus eum Corneliam amare putat.
→ Marcus glaubt, dass er (ein anderer) Cornelia liebt.
Zur Unterscheidung kannst du bei Unsicherheiten in Klammern anmerken, ob es sich um "er selbst" oder "ein anderer" handelt. Übrigens: Wenn du wiedergibst, was jemand sagt oder denkt, kannst du im Deutschen den Konjunktiv nutzen. Zum Beispiel "dass er Cornelia liebe". Das zeigt, dass die Aussage nicht gesichert ist.
Ergänzung des Latein AcI
Der AcI in Latein lässt sich erweitern und zwar um Objekte, Attribute oder Adverbiale – genau wie ein normaler Satz. Diese Erweiterungen machen die Aussage genauer. Wichtig ist: Wenn sie sich auf den Subjektakkusativ beziehen, stehen auch sie im Akkusativ.
Marcus [Corneliam amicam a Gaio comitari] nescit.
→ Marcus weiß nicht, [dass seine Freundin Cornelia von Gaius begleitet wird].
Hier ist "Corneliam" das Subjekt im Akkusativ, "amican" ein Attribut dazu und "a Gaio comitari" ein passives Verb mit Ergänzung. Unser Tipp: Markiere im lateinischen Satz alle Wörter zwischen Akkusativ und Infinitiv mit Klammern. So erkennst du die komplette AcI-Konstruktion auf einen Blick.
AcI Latein: Zeitverhältnis im Blick
Der AcI in Latein wird in verschiedenen Zeitverhältnissen übersetzt, die vom Tempus des Infinitiv abhängen. Je nachdem, ob der Infinitiv im Präsens, Perfekt oder Futur steht, kann die Handlung des AcI gleichzeitig, vorzeitig oder nachzeitig zur Handlung des Hauptsatzes erfolgen.
- Gleichzeitig – Infinitiv Präsens: Der Infinitiv steht im Präsens, wenn die Handlung gleichzeitig mit der des Hauptsatzes geschieht. Zum Beispiel: Lisa wusste nicht, dass Kevin wartete (Lisa nescivit [Kevin manere].
- Vorzeitig – Infinitiv Perfekt: Der Infinitiv im Perfekt zeigt an, dass die Handlung des AcI vor der Handlung des ursprünglichen Satzes stattfand. Zum Beispiel: Lisa wusste nicht, dass Kevin lange gewartet hatte (Lisa nescivit [Kevin desiduo mansisse].
- Nachzeitig – Infinitiv Futur: Der Infinitiv Futur drückt aus, dass die Handlung des ACi nach der Hauptsatzhandlung erfolgt. Zum Beispiel: Lisa wusste nicht, dass Kevin lange warten wurde (Lisa nescivit [Kevin desiduo mansurum esse].
Es ist also wichtig, auf das Tempus des Infinitivs zu achten, um das Zeitverhältnis korrekt zu übersetzen. Die Konjugation und Deklination des Verbs im AcI beeinflussen dabei ebenfalls die genaue Bedeutung und den Verlauf der Handlung.
AcI vs. NcI: Was ist der Unterschied?
Beide Konstruktionen bestehen aus einem Nomen und einem Infinitiv. Doch es gibt auch Unterschiede: Der AcI verwendet den Akkusativ, während der NcI den Nominativ verwendet. Außerdem sind die Verben, nach denen sie auftreten, unterschiedlich.
Der AcI ist eine Ininitivkonstruktion, die aus einem Akkusativobjekt und einem Infinitiv besteht. Er wird oft nach Verben wie sehen, wissen oder glauben verwendet und drückt eine indirekte Rede oder Wahrnehmung aus. Der NcI besteht aus einem Nominativ und einem Infinitiv. Er tritt häufig nach Verben wie sein, werden oder scheinen auf und zeigt eine Zustandsbeschreibung oder eine Aussage über das Subjekt.
Mit KI zusammenfassen: