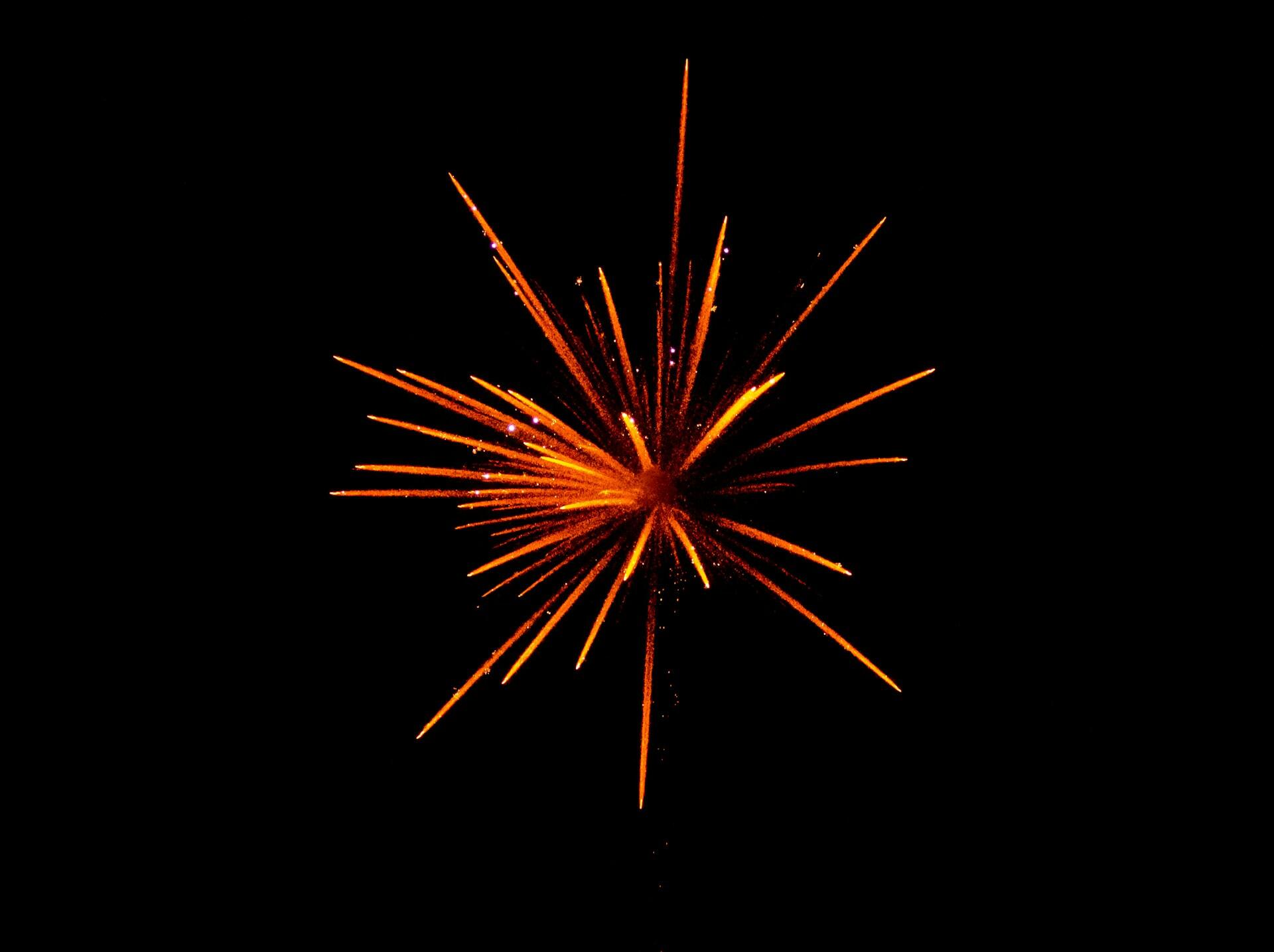Wenn am 1. August in der Schweiz unzählige Höhenfeuer aufleuchten, das Donnergrollen der Feuerwerke durch die Nacht hallt und die Schweizer Fahne an Balkonen, in Gärten und auf öffentlichen Plätzen weht, dann ist klar: Es ist Nationalfeiertag. Ein emotionaler Ankerpunkt im Jahreslauf, an dem sich Traditionen verdichten, weiterentwickeln und Generationen miteinander verbinden.
Die Bräuche am 1. August erzählen viel über das kollektive Selbstverständnis des Landes. Ob im städtischen Umfeld mit grossen Feuerwerken und offiziellen Festreden oder auf dem Land mit beschaulichen Familienfesten, Alphornklängen und Jodelgesang, überall zeigt sich die Vielfalt einer gelebten Tradition. Dabei geht es nicht nur um das Bewahren des Alten, sondern auch um die Frage, wie sich ein moderner Nationalfeiertag anfühlen kann. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf typische Bräuche, ihre Ursprünge und ihre heutige Bedeutung.
💡Wie ist der Nationalfeiertag eigentlich entstanden? Mehr zur Geschichte des 1. August findest du hier.

Feuerwerk in Städten und Dörfern
Schon Tage vor dem eigentlichen Fest knallt es in der Schweiz auf den Strassen: Ein akustischer Vorbote des Nationalfeiertags. Doch in der Nacht selbst erreichen die Lichterspektakel ihren Höhepunkt: Grosse Städte wie Zürich, Luzern oder Genf organisieren beeindruckende Feuerwerke, die Tausende anziehen. Aufwändig inszeniert, musikalisch untermalt und oft am Wasser in Szene gesetzt, gehören sie zu den Highlights vieler 1. August-Feste.
Auch in kleinen Dörfern und Gemeinden ist das Feuerwerk fester Bestandteil der Feierlichkeiten. Dort mag es vielleicht etwas bescheidener ausfallen, dafür umso persönlicher. Familien zünden eigene Raketen, Kinder spielen mit Wunderkerzen und Vulkänen.
Die schönsten Feuerwerke der Schweiz
Einige Orte stechen mit besonders eindrucksvollen Feuerwerken hervor:
- Basel etwa veranstaltet eines der grössten Spektakel am Rhein – ein Ereignis, das Menschen aus der ganzen Region anzieht:
- Ebenso beeindruckend ist das Feuerwerk am Rheinfall bei Schaffhausen, wo die Naturkulisse der donnernden Wassermassen eine dramatische Bühne bietet.
- In Brunnen leuchten die Raketen überm Vierwaldstättersee. Die Umgebung mit See und Bergen macht dieses Feuerwerk besonders eindrücklich.
- Ein weiteres Highlight: Am Thunersee gibt es spektakuläre Feuerwerke, die man vom Seeufer oder aus der Höhe sehen kann.
Historische Ursprünge
Historisch betrachtet gehört das Feuerwerk allerdings nicht zu den ursprünglichen Bräuchen am 1. August. Seine Wurzeln reichen zurück in die frühe Neuzeit, als Feuerwerke bei festlichen Anlässen von Stadtregierungen, Gilden oder Obrigkeiten gezündet wurden, zur Repräsentation und öffentlichen Unterhaltung. Mit der Einführung des Bundesfeiertags im Jahr 1891 bot sich ein neuer Rahmen, um diese festliche Form weiterzuentwickeln. Während die Höhenfeuer auf alten Signalbräuchen basieren, übernahm das Feuerwerk eher die Funktion eines modernen Spektakels: Licht, Lärm und visuelle Kraft als kollektives Erlebnis.
Im Lauf des 20. Jahrhunderts wurde das Feuerwerk dann allmählich zum festen Bestandteil des Nationalfeiertags. Ob als gross inszenierte Stadtveranstaltung oder als privates Vergnügen im Garten.
Gleichzeitig ist der Brauch nicht unumstritten: Wegen Umweltbelastung, Lärmstress und Verletzungsgefahr denken viele Gemeinden inzwischen um. Einige verzichten auf Feuerwerke oder setzen auf leise Alternativen wie Drohnenshows.
Erste dokumentierte Feuerwerke in Schweizer Städten gab es bereits im 16. Jahrhundert – lange bevor der 1. August überhaupt zum Feiertag wurde.
Höhenfeuer – ein alter Signalbrauch
Wenn in der Dämmerung des 1. August Flammen auf Berggipfeln und Anhöhen sichtbar werden, lebt einer der ältesten und symbolträchtigsten Bräuche der Schweiz auf: das Höhenfeuer. Anders als das lautstarke Feuerwerk steht hier das stille Leuchten im Vordergrund. Ein archaisches Zeichen der Gemeinschaft, der Verbundenheit und der schweizerischen Identität.
Wo kommt der Brauch her?
Die Ursprünge dieses Brauchs reichen weit zurück. Bereits im Spätmittelalter wurden sogenannte Hochwachten genutzt: Signalfeuer, mit denen sich Städte und Täler gegenseitig vor Gefahren warnten. Auf exponierten Hügeln entzündet, dienten sie als Kommunikationssystem für grosse Distanzen. Später wurden diese Feuer auch bei besonderen Anlässen angezündet, etwa zur Feier politischer Ereignisse oder als symbolische Mahnfeuer. Eine andere historische Linie sieht Parallelen zu vorchristlichen Sonnenwendfeiern, bei denen Feuer als reinigendes, gemeinschaftsstiftendes Element galt.
Mit der Einführung des Bundesfeiertags im Jahr 1891 erhielten die Höhenfeuer eine neue Bedeutung. Sie wurden nun bewusst am 1. August entzündet. Als Zeichen des Zusammenhalts, als visuelles Symbol des Nationalgedankens. Heute wird der Brauch vielerorts bewusst gepflegt. Freiwillige oder lokale Vereine sammeln Holz, tragen es auf Bergspitzen, Hochebenen oder Aussichtspunkte und errichten kunstvoll gestapelte Feuerstösse. Der eigentliche Akt des Holztragens, oft verbunden mit einer Wanderung oder einem kleinen Fest, ist bereits Teil des Rituals.
In einigen Gemeinden ist das Feuer in ein grösseres Rahmenprogramm eingebettet – mit Apéro, Alphornklängen, Fackelumzügen oder traditionellen Festreden. Besonders beliebt sind Orte, bei denen man das Feuer in Kombination mit einem schönen Panorama oder gastronomischem Angebot erleben kann, etwa auf dem Stanserhorn oder dem Gitschen in Uri.
Wo kann man in der Schweiz besonders eindrückliche Höhenfeuer sehen?
Einige Regionen sind für ihre Höhenfeuer besonders bekannt. So brennen auf den Gipfeln der Churfirsten im Toggenburg gleich mehrere Feuer in einer spektakulären Reihe – ein noch junger, aber stark beachteter Brauch. Am Vorderglärnisch im Glarnerland wird das Feuerholz bereits seit 1935 traditionsgemäss von Wandernden hochgetragen. Auch die Region rund um den Thuner- und Brienzersee bietet eine besonders eindrückliche Szenerie: Die Kombination aus Feuern auf den umliegenden Berghängen und dem Blick auf den glitzernden See macht das Erlebnis unvergesslich. In der Innerschweiz, etwa in Uri, Obwalden oder Nidwalden, gehören die Feuer fest zum kulturellen Selbstverständnis: Viele Gipfel leuchten hier gleichzeitig, und das Flammenmeer ist schon von weitem sichtbar.
| Ort | Besonderheit |
| Churfirsten (St. Gallen / Toggenburg) | Hier brennen mehrere Höhenfeuer gleichzeitig auf den Gipfeln der Churfirsten. Das Projekt ist relativ jung aber beliebt wegen der sichtbaren Kette von Flammen auf den Bergrücken. |
| Vorderglärnisch (GL) | Ein schönes Beispiel, weil das Feuerholz seit 1935 von Wandernden hochgetragen wird. Der Weg und das Tragen selbst sind Teil des Erlebnisses. |
| Erlebnisregion Uri (z. B. Gitschen, Schwarzgrat oberhalb Schattdorf, Burg) | In dieser Gegend gehören Höhenfeuer wie auch Feuerwerk und Folklore fest zum Programm. Die Feuer sind hier gross und weithin sichtbar. |
| Interlaken / Region Thuner- und Brienzersee | Die Kombination von Höhenfeuern auf umliegenden Berghängen mit Feuerwerk macht die Stimmung besonders eindrücklich. |
| Stanserhorn (Obwalden / Nidwalden) | Feuer in grosser Höhe kombiniert mit Bergrestaurant, Panorama und Feierprogramm – ideal, wenn du Bergsicht, Natur und Festliches verbinden willst. |
☝️ Damit man beim Spektakel gut durchhält gehört natürlich auch das Grillen vorher dazu. Mehr dazu findest du in unserem Beitrag zum typischen Essen am 1. August in der Schweiz.
Politische Festreden
Auch die Worte haben am 1. August Gewicht: Die politischen Festreden, gehalten von Bundesräten, Regierungsmitgliedern oder lokalen Behörden, gehören seit jeher zum festen Bestandteil des Schweizer Nationalfeiertags. Sie bieten Raum für Reflexion, Rückblick und Ausblick, und den Versuch, das Gemeinsame im Vielstimmigen zu benennen.
Woher kommt die Tradition der Festreden?
Historisch gesehen entwickelten sich die Reden mit der Etablierung des Bundesfeiertags ab 1891. Schon früh wurden sie genutzt, um nationale Identität zu festigen und die gemeinsame Geschichte zu würdigen. Besonders die Feierlichkeiten auf dem Rütli, dem symbolischen Ursprungsort der Eidgenossenschaft, haben diesen Brauch geprägt. Dort versammelten sich Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft, um den Geist des Bundesbriefs zu beschwören. Eine Praxis, die bis heute gepflegt wird. Im Laufe der Jahre wurden die Reden institutionalisiert und politisch aufgeladen: Als Plattform, um gesellschaftliche Herausforderungen anzusprechen, Werte zu betonen oder auch Kritik zu formulieren.
Worüber heute geredet wird
Heute erfüllen die Festreden auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Funktionen. Wenn ein Bundesrat spricht, dann ist das nicht nur eine symbolische Geste, sondern auch ein Kommunikationsmittel der Landesregierung. Es geht darum, Orientierung zu geben. Sei es in Krisenzeiten, bei gesellschaftlichen Debatten oder zur Vergewisserung nationaler Prinzipien. Die Reden greifen Themen wie Solidarität, Freiheit, Sicherheit oder die Rolle der Schweiz in einer globalisierten Welt auf. Gerade in Jahren, die von Unsicherheit geprägt sind – etwa durch Pandemien, Kriege oder wirtschaftliche Spannungen – kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu.
Auf lokaler Ebene hingegen sind die Festreden oft persönlicher und direkter. Gemeindepräsidenten, Kantonsräte oder lokale Persönlichkeiten sprechen zur Geschichte ihrer Region, lokale Errungenschaften oder das, was die Gemeinschaft im Alltag zusammenhält.

Musik & Kultur: Alphorn, Jodeln, Blasmusik
Keine 1. August-Feier wäre komplett ohne die Klänge, die tief in der Schweizer Volkskultur verwurzelt sind. Musik spielt eine zentrale Rolle am Nationalfeiertag: Das Spektrum reicht von feierlich geblasenen Alphörnern zu traditionellen Jodel bis hin zu festlicher Blasmusik, die auf Dorfplätzen oder vor Gemeindehäusern erklingt.
Alphorn und Jodeln: Ehemalige Kommunikationskanäle
Besonders das Alphorn gehört einfach zum 1. August dazu: Der tiefe, ruhige Klang, der durch Hügel und Täler zieht. An vielen Orten eröffnet ein Alphornbläser oder ein kleines Trio ganz feierlich das Programm.
Früher hatte das Alphorn allerdings eine ganz praktische Funktion: Es wurde von Hirten genutzt, um Tiere zu rufen oder mit anderen Alpenbewohnern über weite Distanzen hinweg zu kommunizieren. Es war ein Werkzeug, kein Musikinstrument im heutigen Sinn. Erst im 19. Jahrhundert, als man begann, die Alpen romantisch zu verklären und Volkskultur zu pflegen, rückte das Alphorn langsam ins Rampenlicht. Es wurde zum Symbol für die „echte“, einfache Schweiz.
Heute steht das Alphorn in der Schweiz nicht nur für Tradition, sondern auch für Identität. Es wird gelehrt, gespielt, gepflegt und gehört bei vielen Anlässen einfach dazu. Das Alphorn gehört so selbstverständlich zum 1. August, weil es wie kaum ein anderes Symbol die zentralen Themen dieses Tages verkörpert: Heimat, Naturverbundenheit, Brauchtum.
👂Zum Reinhören:
Auch der Jodel ist ein fester Bestandteil vieler 1. August-Programme. Was ebenfalls einst als Kommunikationsform zwischen Alphütten diente, hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer musikalischen Ausdrucksform entwickelt, die tief im ländlichen Raum verankert ist. Am 1. August gehört der Jodel heute vielerorts zum offiziellen oder kulturellen Rahmenprogramm, manchmal in Kombination mit Alphorn oder Blasmusik. Gesungen werden traditionelle Naturjodel, Zäuerli oder Kompositionen, die eigens für Chöre arrangiert wurden.
👉 Und für alle, die schonmal üben wollen:
Blasmusik am 1. August: Klang gewordene Gemeinschaft
Wer schon einmal eine 1. August-Feier besucht hat, kennt den Klang: Marschmusik, Volkslieder, vielleicht ein moderneres Stück, gespielt von der lokalen Musikgesellschaft, mitten auf dem Dorfplatz oder vor dem Gemeindehaus. Blasmusik gehört einfach dazu. Die Wurzeln dieses Brauchs reichen ins 19. Jahrhundert zurück. Damals entstanden überall im Land Musikvereine, viele davon bestehen bis heute. Auch der Schweizer Blasmusikverband wurde schon 1862 gegründet. Bis heute proben viele Musikgesellschaften das ganze Jahr für ihren grossen Auftritt am Nationalfeiertag. Gerade in kleineren Gemeinden ist das ein fester Termin im Kalender.
Apropos kleine Gemeinden: Wie genau der 1. August gefeiert wird, ist natürlich auch unterschiedlich, je nachdem wo man sich befindet. Hier haben wir die Unterschiede zwischen Stadt, Land und Kantonen am Schweizer Nationalfeiertag genauer erklärt.
Fahnenschmuck & patriotische Symbole
Die Schweizer Flagge weht am 1. August an Balkonen, hängt an Gartenmauern, flattert auf Gemeindeplätzen oder wird als kleines Fähnchen auf dem Zopf beim Brunch gesteckt. Der Fahnenschmuck ist überall. Und obwohl viele dieser Dekorationen heute aus dem Supermarkt stammen, steckt dahinter eine tiefere symbolische Bedeutung.
Die Schweizer Flagge mit dem weissen Kreuz auf rotem Grund ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts das offizielle Staatssymbol, gesetzlich verankert wurde sie 1889. Doch ihre Ursprünge reichen bis ins Mittelalter zurück, als das Kreuz als Feldzeichen von eidgenössischen Truppen genutzt wurde. Der Fahnen Gebrauch am 1. August wurde spätestens mit der Einführung des Bundesfeiertags 1891 institutionalisiert. Seither ist der sichtbare Einsatz nationaler Symbole Teil des Programms – ähnlich wie Höhenfeuer oder Festreden.
Neben den klassischen Fahnen treten am Nationalfeiertag auch andere patriotische Elemente in Erscheinung: Lampions mit Kreuzmotiv, rot-weiss geschmückte Tische, Alphorn- und Edelweissmotive auf Plakaten oder Shirts. In manchen Gemeinden werden sogar ganze Häuserfronten beflaggt!
Mitmachen ist unkompliziert. Wer mag, hängt am Balkon eine Flagge auf, stellt rot-weisse Kerzen auf den Gartentisch oder bringt ein paar Lampions ans Geländer. Viele Läden bieten rechtzeitig vor dem 1. August passende Dekoartikel an – von günstigen Papierfähnchen bis zu wetterfesten Stoffflaggen. Auch kleine Gesten wie ein Zopffähnchen beim Frühstück oder ein rot-weiss gedeckter Tisch reichen aus, um ein Zeichen zu setzen.
Moderne Varianten: Familienfeste & urbane Events
Der 1. August wird heute längst nicht mehr überall gleich gefeiert. Neben den klassischen Bräuchen gibt es eine Vielzahl neuer Formen, wie der Nationalfeiertag in der Schweiz begangen wird: Besonders in städtischen Gebieten oder in jüngeren, durchmischten Bevölkerungsschichten. Diese moderneren Varianten stehen nicht im Widerspruch zur Tradition, sondern spiegeln den Wandel einer Gesellschaft, in der kulturelle Identität vielseitiger geworden ist.
- In Städten wie Zürich verzichtet man bewusst auf grosses Feuerwerk. Stattdessen setzt die Stadt auf kleinere Veranstaltungen mit Musik, Kulinarik und Begegnung: Vom offiziellen Festakt am Grossmünster bis zu alternativen Formaten wie Brunch Angeboten, Spaziergängen oder Bootstouren.
- Ähnlich zeigt sich das in Davos, wo eine Drohnenshow das klassische Feuerwerk ersetzt, kombiniert mit Höhenfeuern und einem Stadtfest.
- Auch Zug bietet ein gutes Beispiel für den Wandel: In der Stadt spielt traditionelle Musik wie Alphorn und Ländler zwar eine Rolle, doch es geht weniger um grosse Symbolik als um Geselligkeit und ein gemeinsames Znacht.
- In Brienz und Brienzwiler wird die Kombination aus Tradition und Moderne besonders sichtbar. In Brienz treten Alphornbläser und Fahnenschwinger auf, danach folgt ein See-Feuerwerk. In Brienzwiler beginnt das Programm bereits am Vorabend mit einem Konzert auf dem Schulhausplatz.
- Und in Brunnen zieht sich die Feier zwei Tage lang – mit einem Dorffest, Live-Musik von Ländler bis Rock, einem Feuerwerk überm Vierwaldstättersee und einem gastronomischen Angebot, das nicht auf Folklore, sondern auf Vielfalt setzt.
Nicht jeder zieht es am Nationalfeiertag zu Stadtfesten. Viele feiern den 1. August ganz bewusst im kleinen Rahmen, mit Familie, Freunden, Nachbarn oder einfach nur zu zweit. Beliebt ist ein gemeinsamer Brunch am Morgen, oft mit typischen Produkten wie Zopf, Käse, Konfi oder Rösti. Wer es festlicher mag, deckt den Tisch mit kleinen Schweizer Fähnchen oder rot-weiss gemusterten Servietten – erhältlich in fast jedem Supermarkt schon Tage vor dem Feiertag. Auch der Grill steht bei vielen im Mittelpunkt: Abends trifft man sich draussen, grilliert Würste oder Gemüse, trinkt ein Glas Wein oder Most und geniesst die langen Sommertage.
Fazit: Bräuche im Wandel – lebendig, vielfältig, typisch Schweiz
Der 1. August zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie unterschiedlich Traditionen gelebt werden – und wie stark sie sich im Lauf der Zeit verändert haben. Was früher oft einheitlich wirkte ist heute vielfältiger und regional stark unterschiedlich geprägt. Manche Gemeinden halten an traditionellen Programmen fest, andere setzen auf moderne Events, verzichten auf Feuerwerke oder gestalten den Tag bewusst familienfreundlich. In den Städten wird der Nationalfeiertag oft lockerer angegangen, auf dem Land bleibt er stärker verwurzelt.
Gleichzeitig bleiben viele Bräuche bestehen, auch weil sie an Orten mit lokaler Verankerung weitergetragen werden: durch Vereine, Familien oder Einzelpersonen. Wie genau das aussieht, ist von Ort zu Ort verschieden. Diese Dynamik ist kein Zeichen von Traditionsverlust, sondern von kultureller Vitalität. Der 1. August zeigt, wie sich Identität nicht in starren Formen manifestiert, sondern im gemeinsamen Tun. Sei es auf dem Dorfplatz, in der Stadt oder im eigenen Garten. Und vielleicht ist es gerade dieses Nebeneinander von Alt und Neu, das den Nationalfeiertag so typisch schweizerisch macht: pragmatisch, vielfältig, aber immer mit einem Gespür für das Verbindende.
💡 Spannend? Schau auch bei unserem Artikel zu Ursprung, Bedeutung und typischen Bräuchen des Nationalfeiertags vorbei.
Mit KI zusammenfassen: