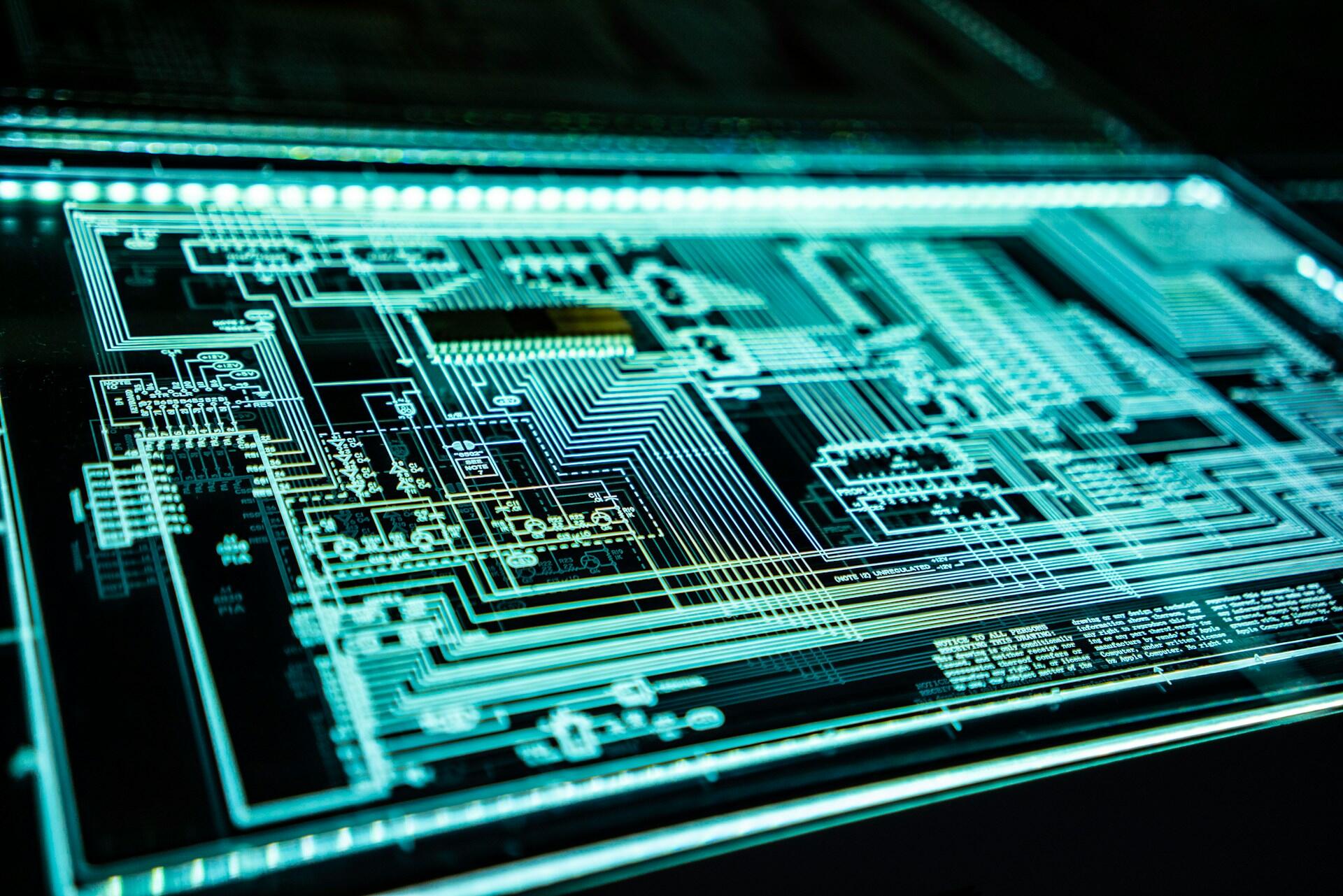Stell dir vor, du kannst dich bei Behörden, Banken oder Online-Diensten sicher und einfach ausweisen. Ohne Papier, ohne langes Warten, nur mit deinem Smartphone. Genau das soll die E-ID Schweiz möglich machen. Die elektronische Identität ist ein entscheidender Schritt in Richtung einer vernetzten, effizienten und selbstbestimmten digitalen Gesellschaft.
Nach dem Nein zur ersten Vorlage im Jahr 2021 hat der Bund das Konzept überarbeitet – nun steht die Einführung der staatlichen digitalen Identität Schweiz kurz bevor. In diesem Beitrag erfährst du, wie die E-ID funktioniert, welche Vorteile sie bringt und worauf du beim Einsatz achten solltest.

Was ist die E-ID in der Schweiz genau?
Bevor wir tiefer eintauchen, wie die E-ID eigentlich funktionieren wird, sollten wir zuallererst klären: Was bedeutet die digitale Identität überhaupt?
Die E-ID ist im Grunde dein digitaler Ausweis für Bürger der Schweiz: Ein offizieller Nachweis deiner Identität im Internet, ausgestellt und garantiert vom Schweizer Staat. Während du heute beim Online-Einkauf, bei der Kontoeröffnung oder beim Login bei einer Behörde noch mit Benutzername, Passwort oder einer Kopie deines Ausweises hantierst, soll die E-ID all das vereinfachen und sicherer machen. Sie ist also kein zusätzliches Login-Tool, sondern ein digitaler Identitätsnachweis. Sie kann für viele Online-Behördendienste und private Anwendungen genutzt werden, ersetzt aber den physischen Ausweis nicht vollständig. In der Schweiz soll die E-ID ein vom Staat anerkanntes Mittel sein, mit dem du deine Identität online nachweisen kannst, ohne jedes Mal einen physischen Ausweis vorlegen zu müssen. Für eine schnelle Einordnung der Debatte findest du hier einen kompakten Überblick über Pros und Contras: Vorteile und Nachteile der E-ID Schweiz.
📺 Hier auch ein ausführliches Video zu den gesetzlichen Hintergründen:
Das Prinzip der digitalen Identität
Technisch funktioniert das über eine staatlich geprüfte digitale Identität, die du als Schweizer Bürger über die swiyu App verwaltest. Nach einer einmaligen Identitätsprüfung (z. B. durch Scannen deines Ausweises und ein Selfie zur Bestätigung) wird deine digitale Identität in verschlüsselter Form gespeichert. Von da an kannst du sie überall dort einsetzen, wo ein sicherer Identitätsnachweis nötig ist: bei Online-Verwaltungsdiensten, Versicherungen, Banken oder sogar beim Altersnachweis im Laden.
Das Ziel ist, dass du selbst bestimmst, welche Informationen übermittelt werden: Wenn du etwa nur bestätigen musst, dass du über 18 bist, soll die E-ID nicht dein Geburtsdatum, sondern lediglich diese Information übertragen. In der Anfangsphase wird die selektive Datenfreigabe schrittweise ausgebaut.
Die E-ID im Alltag
Was ist also gemeint mit «digitale Identität»? Vereinfacht gesagt: Dein digitales Ich, das Behörden, Unternehmen oder Online-Dienste sicher erkennen und vertrauen können. In der Praxis heisst das: Du erhältst eine digitale Identifikationsmöglichkeit – z. B. über eine App auf deinem Smartphone –, die mit staatlich geprüften Ausweisdaten verknüpft ist. Diese Möglichkeit erlaubt dir dann, im Netz oder bei bestimmten Geschäften deine Identität nachzuweisen, ohne jedesmal persönlich erscheinen oder Papierformulare ausfüllen zu müssen.
👉 Welche Szenarien sich im Alltag konkret ergeben – von Behördenlogin über Bank-Onboarding bis hin zu digitalen Diplomen – haben wir hier bündig gesammelt: E-ID: Anwendungen im Alltag.
Wie funktioniert die E-ID konkret?
Die Technik hinter der E-ID klingt auf den ersten Blick nach Hightech, doch das Grundprinzip ist nachvollziehbar. Im Kern geht es darum, eine staatlich geprüfte, digitale Version deiner Identität zu erstellen, die du sicher auf deinem Smartphone verwalten und flexibel einsetzen kannst.
1. Registrierung und Identitätsprüfung
Der Einstieg in die E-ID erfolgt über eine speziell entwickelte App (z. B. eine digitale Wallet-App). Diese App dient als deine persönliche, sichere Identitätsmappe. Du beginnst, indem du deine persönlichen Daten eingibst und deinen amtlichen Ausweis (den Schweizer Pass oder die Identitätskarte) mit der Smartphone-Kamera einscannst. Zusätzlich wird meist ein Selfie verlangt, das mit deinem Ausweisfoto abgeglichen wird. Diese biometrische Verifikation stellt sicher, dass du tatsächlich die Person bist, die du vorgibst zu sein.
Sobald diese Angaben hochgeladen sind, prüft eine vom Bund autorisierte Stelle (beispielsweise das Bundesamt für Polizei fedpol oder ein kantonaler Ausweisdienst) die Daten. Das System gleicht sie mit den offiziellen Registern ab – ähnlich wie bei der Pass- oder ID-Ausstellung. Wenn alles übereinstimmt, erhältst du eine digitale Bestätigung deiner Identität. Ab diesem Moment bist du offiziell „digital identifiziert“.
Im Unterschied zu früheren Modellen bleibt in der Schweiz der Bund die ausstellende Instanz. Private Anbieter können aber technische Komponenten wie Wallets oder Schnittstellen betreiben, sofern sie staatlich zertifiziert sind.
2. Digitale Speicherung und Nutzung deiner Identität
Nach erfolgreicher Prüfung bekommst du deine E-ID. Diese wird in Form von digitalen Identitätsnachweisen (sogenannten „Credentials“) in deiner App gespeichert. Die Nachweise sind verschlüsselt und werden grundsätzlich lokal auf deinem Gerät gespeichert. Nur die notwendigen Zertifikats- und Prüfdaten liegen auf staatlichen Vertrauensservern, nicht aber deine persönlichen Identitätsdaten.
Die Technik dahinter basiert auf einem dezentralen Identitätssystem (Self-Sovereign Identity, kurz SSI). Das bedeutet: Du bestimmst selbst, welche Daten du an wen weitergibst. Möchtest du etwa dein Alter nachweisen, übermittelst du lediglich die Information „über 18“, nicht aber dein genaues Geburtsdatum. Diese selektive Datenfreigabe wird durch digitale Signaturen abgesichert, die von staatlich anerkannten Zertifizierungsstellen stammen. Deine E-ID kann in Zukunft auch weitere Nachweise integrieren, etwa Führerausweis, Wohnsitzbestätigung oder Studentenausweis.
3. Online- oder Offline-Anwendung
Sobald deine digitale Identität vorliegt, kannst du sie nutzen: Sowohl online als auch offline.
Online bedeutet etwa: Du loggst dich bei einem Bundes- oder Kantonsdienst, einer Bank, einer Versicherung oder einer E-Commerce-Plattform ein. Anstatt neue Benutzerkonten zu erstellen, bestätigst du deine Identität mit deiner E-ID-App. Das funktioniert ähnlich wie beim Login via Mobile ID oder SwissID.
Künftig sind auch Offline-Anwendungen denkbar (etwa Altersnachweise per QR-Code), solche Funktionen werden derzeit jedoch noch getestet. Wenn du z. B. im Laden Alkohol kaufst, könnte so einfach überprüft werden, ob du über 18 bist, ohne, dass du dein Geburtsdatum oder Adresse offenlegen musst.
Auch bei Verwaltungsangelegenheiten – etwa beim Anmelden einer neuen Adresse, beim Steuerportal oder bei der Stimmabgabe im Ausland – wird die E-ID künftig den Identitätsnachweis vereinfachen. Sie wird also zu einem universellen digitalen Schlüssel für dein Leben in der Schweiz.
4. Verwaltung und Kontrolle
Das Herzstück des Systems ist die Selbstbestimmung über deine Daten. In der E-ID-App kannst du jederzeit sehen, welche Organisationen welche Daten angefragt haben und du kannst diese Freigaben aktiv verwalten oder widerrufen.
Der Staat schafft lediglich die Vertrauensinfrastruktur (die technische und rechtliche Basis), auf der alle Identitätsnachweise sicher ausgetauscht werden können. Die Nutzung bleibt freiwillig, und die Datenhoheit liegt bei dir.
Technisch umgesetzt wird dies durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Blockchain-ähnliche Vertrauensanker und strenge Sicherheitsstandards, die sich an der EU-Verordnung eIDAS 2.0 orientieren. Das System ist so ausgelegt, dass nur du den Zugriff auf deine Identitätsdaten kontrollierst. Vollständige Sicherheit lässt sich nie garantieren, aber durch starke Verschlüsselung und regelmässige Audits wird ein sehr hohes Schutzniveau erreicht.
So entsteht ein digitales Identitätssystem, das zwar zentral verwaltet, aber dezentral kontrolliert wird – ein feiner Unterschied, der die Schweizer E-ID im internationalen Vergleich einzigartig macht.

Was technisch hinter der E-ID steckt
Hinter der E-ID steckt eine durchdachte technische Infrastruktur: Im Zentrum steht eine sogenannte digitale Wallet, also eine sichere App, die deine digitalen Identitätsnachweise speichert. Das ist vergleichbar mit einem elektronischen Portemonnaie. Dort liegen deine persönlichen Angaben verschlüsselt, und zwar dezentral auf deinem Gerät, nicht auf einem zentralen Server des Staates.
Wenn du dich irgendwo digital ausweisen willst, erfolgt der Datenaustausch verschlüsselt und nur mit deiner ausdrücklichen Zustimmung. Das System nutzt moderne kryptografische Verfahren wie digitale Signaturen und sogenannte Zero-Knowledge-Proofs, mit denen sich Eigenschaften – etwa dein Alter oder deine Staatsangehörigkeit – nachweisen lassen, ohne dass alle persönlichen Daten offengelegt werden müssen.
Die technische Grundlage bildet eine staatlich betriebene Vertrauensinfrastruktur, die aus mehreren Komponenten besteht: einer Ausgabestelle, die deine Identität einmalig überprüft; einer Verifikationsplattform, die prüft, ob ein Nachweis echt ist; und einer Schnittstelle für Unternehmen oder Behörden, die die E-ID in ihre digitalen Dienste einbinden wollen. Dadurch bleibt das System interoperabel, also mit verschiedenen Diensten kompatibel, und erfüllt internationale Standards wie die europäischen eIDAS-Richtlinien.
👉 Wer tiefer in die Schutzmechanismen wie Kryptografie, selektive Offenlegung und Governance einsteigen möchte, findet hier eine vertiefte Analyse: Datenschutz und Risiken der E-ID.
Chancen und Grenzen
Die technische Architektur der E-ID bringt viele Stärken mit sich, birgt aber auch einige Herausforderungen. Positiv fällt auf, dass die dezentrale Speicherung der Identitätsdaten einen echten Fortschritt in puncto Datenschutz für alle Bürgerinnen und Bürger bedeutet. Deine sensiblen Informationen liegen nicht auf einem staatlichen Server, sondern sicher verschlüsselt auf deinem eigenen Gerät – du entscheidest also, wann und mit wem du sie teilst. Auch die Verwendung moderner kryptografischer Verfahren wie digitale Signaturen oder Zero-Knowledge-Proofs sorgt für ein hohes Sicherheitsniveau und macht Manipulation nahezu unmöglich. Damit wird die E-ID zu einem der sichersten digitalen Ausweissysteme in Europa.
Doch wo Technik Sicherheit bietet, entstehen auch neue Abhängigkeiten. Die Funktionsweise der E-ID setzt voraus, dass Nutzerinnen und Nutzer ein gewisses technisches Verständnis mitbringen und ein modernes Smartphone besitzen. Gerät oder App verloren zu haben, kann den Zugang kurzfristig erschweren, auch wenn Wiederherstellungsmechanismen vorgesehen sind. Zudem ist das Vertrauen in die verwendete Technologie entscheidend: Fehler in der Software oder Sicherheitslücken könnten, zumindest theoretisch, grosse Auswirkungen haben. Kritiker weisen deshalb darauf hin, dass Transparenz und regelmässige, unabhängige Sicherheitsprüfungen unerlässlich sind.
Geplante Timeline und Funktionen der E-ID
Die Einführung der E-ID in der Schweiz ist gestaffelt geplant, und obwohl das Gesetz bereits verabschiedet ist, steht noch viel Umsetzungsarbeit bevor. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass die E-ID «frühestens Anfang 2026» angeboten werden kann. In zahlreichen Quellen wird zudem erwähnt, dass nach einer Ja-Abstimmung (die im September 2025 stattfand) die ersten Nutzungsmöglichkeiten bereits ab 2026 beginnen sollen.
Zudem umfasst die Umsetzung mehrere Phasen:
- Zunächst Aufbau der Vertrauens- und Identitätsinfrastruktur: Der Bund arbeitet auf verschiedenen Ebenen an der technischen Plattform, den Schnittstellen und gesetzlichen Grundlagen.
- Danach folgt der Roll-out: Nutzerinnen und Nutzer können sich registrieren und ihre digitale Identität beantragen. Erste Dienste, bei denen die E-ID akzeptiert wird — zum Beispiel bei Bundes-Onlineportalen oder digitalen Verwaltungsdiensten.
- Im Anschluss kommt die Skalierung und Erweiterung: Weitere Funktionen wie Altersnachweis im Laden oder Integration mit Banken, Versicherungen und privaten Diensten sollen folgen. Laut Fachbeiträgen soll ab 2027 der Schwerpunkt auf Ausbau des Ökosystems und breiter Akzeptanz liegen.
Was die Funktionen angeht, sind folgende Einsatzbereiche vorgesehen:
👉 Der digitale Identitätsnachweis online bei Behörden, Kantonen, Banken oder Versicherungen also statt Ausweis, Kopien etc.
👉 Datenminimal-Freigabe: Du sollst künftig nur die nötigsten Informationen preisgeben – beispielsweise „über 18“ statt Geburtsdatum. Das Gesetz sieht das Prinzip der Datensparsamkeit vor.
👉 Offline-Nachweise oder physische Einsätze: Zwar noch nicht vollständig spezifiziert, aber in Konzepten wurden Anwendungen wie Altersnachweis im Laden oder Identitätsprüfungen vor Ort angedacht.
👉 Freiwilligkeit und Kostenfreiheit: Die Nutzung soll freiwillig sein, ohne obligatorischen Zwang – und gratis angeboten werden.
Kurz: 2026 markiert den angestrebten Startpunkt, gefolgt von einem Verlauf, in dem Schritt für Schritt mehr Dienste angeschlossen werden und die E-ID in Alltag und Verwaltung breit einsetzbar wird.
Fazit: So funktioniert die E-ID in der Praxis
Kurz gesagt: Die E-ID ist dein digitaler Ausweis fürs Smartphone. Du registrierst dich einmal über eine staatlich kontrollierte App, verifizierst deine Identität mit Ausweis und Selfie und bekommst danach eine digitale Identität, die genauso gültig ist wie dein physischer Ausweis. Diese Identität liegt verschlüsselt auf deinem Gerät, nicht auf einem Server, und du entscheidest selbst, welche Daten du wann freigibst.
Im Alltag heisst das: Du kannst dich mit wenigen Klicks bei Behörden, Banken oder Online-Diensten sicher anmelden, Verträge abschliessen oder dein Alter nachweisen – ganz ohne Papier oder komplizierte Logins. Die E-ID macht bürokratische Prozesse einfacher, spart Zeit und sorgt gleichzeitig für mehr Datenschutz und Privatsphäre, weil du nur die Informationen teilst, die wirklich nötig sind. Einmal eingerichtet, wird sie zum digitalen Schlüssel für viele Bereiche des täglichen Lebens in der Schweiz.
👉 Und wer jetzt noch mehr zu der politischen Entscheidung lesen möchte wird in diesem Artikel fündig: E-ID Abstimmung 2025.
Mit KI zusammenfassen: