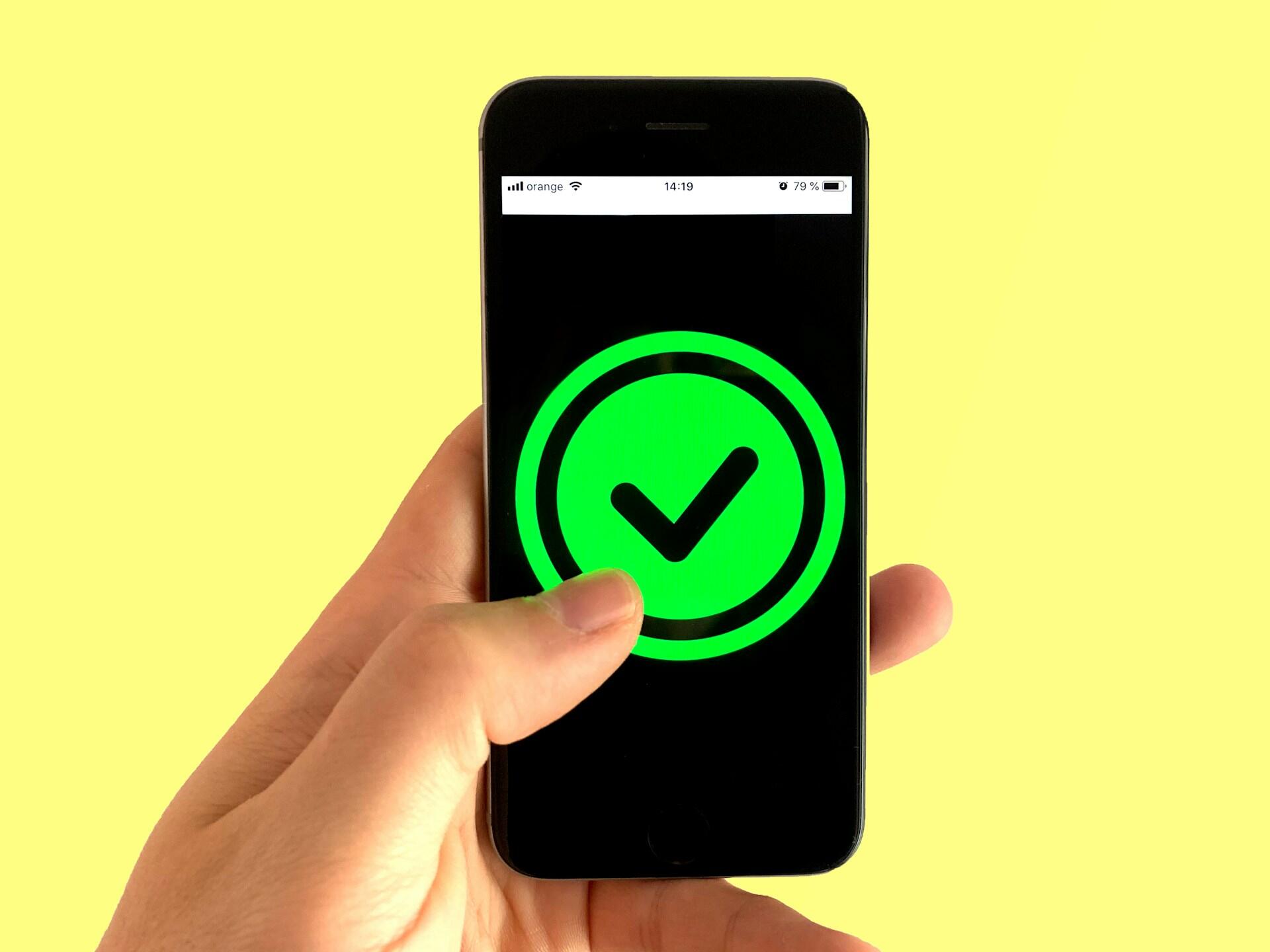Die Einführung einer staatlichen elektronischen Identität war eines der prominentesten Digitalisierungsprojekte der letzten Jahre in der Schweiz. Nach dem gescheiterten Anlauf 2021 hat der Bund eine neue Vorlage erarbeitet, die in der Volksabstimmung vom September 2025 knapp angenommen wurde.
In einer direkten Demokratie wie der Schweiz ist es entscheidend, dass solche technologischen Veränderungen nicht einfach durchgewunken, sondern breit diskutiert werden. Genau das ist bei der E‑ID geschehen: Es wurde viel diskutiert und Argumente abgewogen. Befürworter sehen in der E‑ID einen Meilenstein für den digitalen Staat sehen, Kritiker warnenvor Datenschutzrisiken und gesellschaftlicher Spaltung warnen.
In diesem Beitrag bekommst du einen umfassenden Überblick: Wie funktioniert die E‑ID? Welche Vorteile bringt sie? Und wo liegen die Risiken - Stichworte Überwachung, technische Schwachstellen oder soziale Ausgrenzung? Was sagen Befürworter, was Kritiker?

Warum die E‑ID Schweiz jetzt Thema ist
In Zeiten, in denen Behörden‑ und Privatdienste zunehmend online stattfinden, lautet eine zentrale Frage: Wie identifizieren wir uns im Netz sicher und zugleich datenschutzkonform? In der Schweiz soll dafür künftig eine staatlich herausgegebene digitale Identität eingeführt werden.
Bereits 2021 wurde eine Vorlage zur Schweizer E‑ID auf Bundesebene deutlich abgelehnt. Ein Hauptgrund: Private Unternehmen sollten damals die digitale Identität bereitstellen. Jetzt kommt eine neue Version: Der Bund übernimmt Verantwortung, verspricht Freiwilligkeit, kostenlose Nutzung und eine datensparsame Lösung.
Laut dem offiziellen Ergebnis vom wurde das neue E‑ID‑Gesetz mit 50,4 % Zustimmung angenommen. Damit steht nun fest: Die Schweiz hat dem Gesetz zur Einführung einer staatlichen, freiwilligen und möglichst datensparsamen Schweizer elektronischen Identität („E‑ID“) zugestimmt. Nach dem knappen Ja geht es nun in die Umsetzungsphase: Der Bund und die Kantone erarbeiten gemeinsam den Fahrplan, damit die E‑ID ab Ende 2026 eingeführt werden kann. Wer die politische Vorgeschichte und den Urnengang vertiefen will, findet die Eckdaten hier: Abstimmung über die E-ID Schweiz
So funktioniert die E‑ID praktisch
Zunächst zur Technik und zum Ablauf – damit du weisst, worüber genau debattiert wird.
Die Schweizer E‑ID wird über eine App auf dem Smartphone beantragt. Man lädt die App herunter, scannt den eigenen Pass oder die Identitätskarte und macht ein kurzes Selfie-Video zur Gesichtserkennung. Die erfassten Daten werden anschliessend vom zuständigen Bundesamt – voraussichtlich dem Fedpol – geprüft und bestätigt. Sobald die Verifizierung abgeschlossen ist, wird die E‑ID auf dem Smartphone gespeicher. Von diesem Moment an kann man sich online damit ausweisen: bei Behörden, Versicherungen, Banken oder auch für einfache Altersverifikationen.
Die technische Grundlage der E‑ID basiert auf kryptographischen Verfahren, insbesondere sogenannten Zero-Knowledge-Proofs. Diese ermöglichen es, Informationen zu bestätigen, ohne sie tatsächlich offenlegen zu müssen. Ziel ist es, möglichst wenig persönliche Daten übermitteln zu müssen, aber dennoch eine hohe Sicherheit zu gewährleisten.
Ein kryptographisches Verfahren, das es erlaubt, etwas zu beweisen, ohne Details preiszugeben.
Beispiel: Du kannst nachweisen, dass du über 18 bist, ohne dein Geburtsdatum zu nennen.
Vorteil: Höherer Datenschutz, weniger Preisgabe persönlicher Informationen.
Nach dem knappen Ja an der Urne hat der Bundesrat angekündigt, die E‑ID bis frühestens Ende 2026 flächendeckend bereitzustellen. Bis dahin soll die Infrastruktur aufgebaut, die rechtlichen Rahmenbedingungen verfeinert und die Benutzerfreundlichkeit der App getestet werden.
👉 Für die Grundlagen hier alles zur Funktionsweise der digitalen Identität.

Datenschutz und Grundrechte
Personen‑Identifikationssysteme wie die E‑ID berühren mehrere rechtliche Dimensionen: Datenschutzgesetzgebung, Grundrechte auf Privat‑ und Persönlichkeitsbereich, sowie technische Governance.
In der Schweiz gilt das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), das seit 2023 in der neuen Fassung in Kraft ist. Der zuständige Datenschutzbeauftragte ist der Eidgenössischer Datenschutz‑ und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB). Für die Schweizer E‑ID heißt das konkret: Daten müssen zweckgebunden, minimal, transparent verarbeitet werden. Das Gesetz legt Prinzipien der Datensparsamkeit und Verhältnismässigkeit nahe.
Der erwähnte Diskussionsbericht zur E‑ID skizziert etwa den Ansatz «Self‑Sovereign Identity» (SSI) als mögliche Architektur: Nutzer behalten mehr Kontrolle über ihre Identität – so könnte ein Modell aussehen, wo die Identität dezentral gespeichert wird. Ein wichtiger Begriff lautet «Unlinkability»: Datenverarbeitungen sollen möglichst nicht erlauben, dass Identitätsnachweise verschiedener Transaktionen miteinander verknüpft werden können. Gegner sehen hier noch Lücken.
Auch wenn die Vorlage ausdrücklich Freiwilligkeit, Datensparsamkeit und staatliche Herausgabe vorsieht, bleibt der Grad der Umsetzung entscheidend. Gesetzes‑ und Technikgestaltung können abweichen, Sicherheitsvorfälle sind nie ausgeschlossen. Rechtlich gilt es auch, dass digitale Systeme nicht dazu führen dürfen, dass analoge Zugänge faktisch abgebaut werden, andernfalls entsteht indirekter Zwang und Ungleichheit.
Die Vorteile der E‑ID – was spricht dafür?
👉 Hier die Übersicht der wichtigsten positiven Argumente im Schnelldurchlauf:
| Alltagserleichterung | Die E‑ID vereinfacht digitale Prozesse wie Kontoeröffnung, Versicherungsabschluss oder Behördenkontakte. |
| Staatliche Verantwortung | Im Gegensatz zur alten Vorlage liegt die E‑ID jetzt vollständig in staatlicher Hand. |
| Datensparsamkeit und Kontrolle | Es werden nur unbedingt notwendige Informationen übermittelt. Technisch schützt moderne Kryptographie vor unnötiger Datenweitergabe. |
| Internationale Anschlussfähigkeit | Die E‑ID hilft der Schweiz, mit digitalen Standards in Europa mitzuhalten – z. B. gegenüber Estland oder der EU‑ID-Initiative. |
Digitalisierung, die den Alltag erleichtert
Ein zentrales Argument für die Einführung der E‑ID ist die spürbare Vereinfachung im digitalen Alltag. Heute braucht es für viele Dienste in der Schweiz – von der Kontoeröffnung bis zum Steuerdossier – oft umständliche Verfahren, zusätzliche Identitätsnachweise oder gar den Gang aufs Amt. Mit einer einheitlichen, staatlich anerkannten digitalen Identität könnten diese Prozesse stark vereinfacht werden.
Stell dir vor: Du eröffnest ein Bankkonto, schliesst eine Versicherung ab oder meldest dich für einen Behördendienst an und brauchst dazu nur dein Smartphone mit der E‑ID. Kein Post Ident, keine eingeschriebenen Briefe, keine physischen Formulare. Auch alltägliche Dinge wie der Altersnachweis beim Kauf eines Films oder eines Zugtickets mit Ermässigung könnten elegant und datensparsam über die E‑ID abgewickelt werden.
Gerade für Menschen, die mobil eingeschränkt sind oder in abgelegenen Regionen wohnen, kann diese neue Möglichkeit einen echten Mehrwert bringen. Sie sparen Wege, Zeit und oft auch Nerven.
👉 Mehr konkrete Beispiele und Praxisfälle findest du auch in unserem Artikel zu Anwendungen der E-ID im Alltag.
Staatliche Verantwortung statt privatwirtschaftlicher Interessen
Ein weiterer Vorteil: Die neue Schweizer E‑ID wird ausschliesslich vom Bund herausgegeben – im Gegensatz zur früheren Vorlage, die 2021 deutlich verworfen wurde. Damals war vorgesehen, dass private Unternehmen wie Banken oder Versicherer die Identitäten verwalten sollten. Diese Konstruktion stiess auf heftige Kritik, weil wirtschaftliche Interessen über das öffentliche Vertrauen gestellt wurden.
Jetzt übernimmt der Staat die volle Verantwortung: Von der technischen Infrastruktur bis zur Datenverwaltung. Damit wird sichergestellt, dass die E‑ID nicht zu einem kommerziellen Produkt wird, sondern als öffentliches Gut gedacht ist. Viele erhoffen sich dadurch mehr Transparenz, weniger Risiko für Missbrauch und eine stärkere demokratische Kontrolle über die digitale Identität.
Weniger Daten, mehr Kontrolle
Das neue Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass bei der Nutzung der E‑ID nur jene Informationen weitergegeben werden dürfen, die für die jeweilige Anwendung zwingend notwendig sind. Das Motto lautet: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich.“
Das heisst zum Beispiel: Wenn du bei einer Online-Plattform nachweisen musst, dass du volljährig bist, wird lediglich „über 18“ bestätigt – dein genaues Geburtsdatum bleibt verborgen.
Hinter der E‑ID stehen zudem kryptographische Verfahren, die dafür sorgen, dass deine Daten zwar überprüft, aber nicht zentral gespeichert oder umfassend weitergegeben werden. So behältst du die Kontrolle und schützt dich vor Profilbildung und unerwünschter Datensammlung.
Anschlussfähig bleiben
Nicht zuletzt ist die E‑ID ein Schritt in Richtung internationale Anschlussfähigkeit. Die Europäische Union arbeitet seit Jahren an einem einheitlichen Rahmen für digitale Identitäten (EUid), und Länder wie Estland oder Österreich haben bereits funktionierende Modelle im Einsatz.
Für die Schweiz bedeutet das: Wer den Anschluss verpasst, riskiert einen Wettbewerbsnachteil. Etwa im E‑Commerce, bei internationalen Behördendiensten oder im Tourismus. Eine eigene, kompatible E‑ID schafft hier wichtige Voraussetzungen, um mit anderen Ländern mithalten zu können und gleichzeitig Schweizer Standards bei Datenschutz und Sicherheit einzuhalten.
Die Nachteile und Risiken
👉 Und jetzt die prominentesten Kritikpunkte und Argumente der Kritiker. Auch hier direkt die Übersicht:
| Freiwilligkeit unter Druck | Wenn immer mehr Dienste digital-only sind, entsteht potentiell ein Nutzungszwang, gerade für technisch weniger versierte Menschen. |
| Datenkonzentration | Auch bei datensparsamer Auslegung können grosse Datenmengen entstehen. Gegner sehen darin langfristig ein Missbrauchs- oder Überwachungspotenzial. |
| Technische Schwachstellen | Auch sichere Systeme können fehlerhaft umgesetzt werden. Ohne Transparenz und Kontrolle bleibt die Sicherheit theoretisch. |
| Zentralisierte Architektur | Die Architektur der E‑ID könnte, je nach Ausgestaltung, Verknüpfungen zwischen verschiedenen Anwendungen ermöglichen, was die Privatsphäre gefährden könnte. |
| Soziale Ungleichheit | Menschen ohne Smartphone oder digitale Erfahrung könnten ausgeschlossen werden, analoge Alternativen müssen erhalten bleiben. |
Freiwillig, aber wie lange noch?
Einer der zentralen Kritikpunkte rund um die Schweizer E‑ID betrifft die Frage nach der echten Freiwilligkeit. Zwar verspricht das Gesetz, dass niemand zur Nutzung der E‑ID gezwungen wird. Doch Kritiker befürchten, dass dieser Zustand nicht von Dauer sein wird. Denn wenn immer mehr Dienste ausschliesslich digital zugänglich sind, entsteht ein indirekter Zwang: Wer nicht mitmacht, bleibt aussen vor.
Besonders für Menschen ohne Smartphone, mit weniger digitaler Kompetenz oder schlicht wenig Vertrauen in digitale Technologien könnte das bedeuten, dass ihnen gewisse Angebote oder Leistungen faktisch verwehrt bleiben.
Grosse Datenmengen, grosse Verantwortung
Ein weiterer Risikofaktor ist die zentrale Rolle, die Identitätsdaten in einem E‑ID-System spielen. Denn wer sich digital identifiziert, hinterlässt Spuren – egal, wie datensparsam das System konzipiert ist. Kritiker weisen darauf hin, dass über die Zeit grosse Mengen sensibler Informationen entstehen könnten: Wer meldet sich wann, wo, für was an?
Selbst wenn der Staat heute zusichert, dass keine umfassende Speicherung oder Profilbildung erfolgt, gibt es keine Garantie, dass die Architektur der E‑ID nicht langfristig dennoch Begehrlichkeiten weckt. Ob von staatlicher Seite zur Optimierung von Prozessen oder von kommerziellen Akteuren, die sich Zugang verschaffen wollen. Die Geschichte digitaler Infrastrukturen zeigt: Wo Daten gesammelt werden, steigt früher oder später auch das Risiko ihres Missbrauchs.
Technische Schwachstellen – kein System ist unverwundbar
So fortschrittlich und sicher die Technologie auch sein mag: Kein System ist frei von Risiken. Die E‑ID basiert auf kryptographischen Verfahren, die in der Theorie sehr robust sind. Doch Implementierungsfehler, Sicherheitslücken in der App, unzureichende Tests oder menschliches Versagen könnten auch zu Schwachstellen führen.
Kritische Stimmen fordern daher mehr Transparenz: Der Quellcode der App soll offen einsehbar sein, unabhängige Sicherheitsprüfungen müssten verpflichtend durchgeführt werden, und auch Meldeverfahren für Schwachstellen müssten gesetzlich verankert sein. Bislang fehlt es laut Gegnern an solchen Mindestgarantien.
👉 Eine vertiefte Einordnung zu Rechtsgrundlagen, Architekturprinzipien wie SSI und „Unlinkability“ sowie praktischen Schutzmechanismen findest du hier: Datenschutz E-ID Schweiz.
Zentralisierte Strukturen
Ein weiteres diskutiertes Thema ist die Architektur der E‑ID. Wird sie zentral organisiert oder dezentral? Können unterschiedliche Anbieter die Daten verknüpfen? Welche Kontrollmechanismen sind vorgesehen?
Ein zentrales Prinzip im Datenschutz lautet „Unlinkability“ – also die Unmöglichkeit, verschiedene digitale Nachweise einer Person miteinander zu verknüpfen. Wird das nicht konsequent umgesetzt, entsteht ein gefährliches Potenzial: Bewegungsprofile, Verhaltensanalysen und digitale Dossiers wären technisch machbar, auch wenn sie gesetzlich verboten sind.
Gegner der Vorlage sehen genau hier eine grosse Schwachstelle: Die E‑ID könnte zur Infrastruktur werden, über die sich künftig weitreichende Informationen über das Verhalten einzelner Personen ableiten lassen. Gerade in einem Staat mit starken demokratischen Institutionen sollte diese Möglichkeit ausgeschlossen sein.
Gefahr der digitalen Spaltung
Zuletzt stellt sich auch die Frage nach der sozialen Dimension. Wer profitiert von der E‑ID und wer nicht? Während technikaffine Nutzer das System schnell adaptieren dürften, gibt es viele, für die digitale Identifikation eine hohe Einstiegshürde darstellt.
Ob ältere Menschen, sozial benachteiligte Gruppen oder Personen ohne Zugang zu einem modernen Smartphone: Sie könnten im Alltag zunehmend ausgeschlossen werden, wenn die E‑ID zur Standardlösung wird. Kritiker fordern eine Garantie, dass niemand ausgeschlossen wird. Hier liegt es am Gesetzgeber und an der Umsetzung, sicherzustellen, dass die analogen Alternativen nicht nur formal bestehen, sondern auch wirklich nutzbar bleiben.
Zwischen Fortschritt und Verantwortung
Die Abstimmung zur E‑ID hat deutlich gezeigt: Die Schweiz steht digital an einem Wendepunkt. Während Befürworter im neuen Gesetz eine moderne, sichere und staatlich kontrollierte Lösung sehen, warnt das gegnerische Komitee vor zu viel Zentralisierung, unklaren Garantien beim Datenschutz und einer möglichen digitalen Spaltung.
Sowohl die technischen Chancen als auch die gesellschaftlichen Risiken sind real und genau deshalb ist es wichtig, alle Argumente anzuhören und die Umsetzung kritisch zu begleiten. Eine E‑ID kann den Alltag spürbar erleichtern, wenn sie freiwillig bleibt, transparent betrieben wird und allen zugänglich ist. Entscheidend wird nun sein, ob der Bund seine Versprechen einlöst und die digitale Identität in der Schweiz tatsächlich zum öffentlichen Gut wird, mit klaren Garantien für Sicherheit, Datenschutz und Gleichbehandlung.