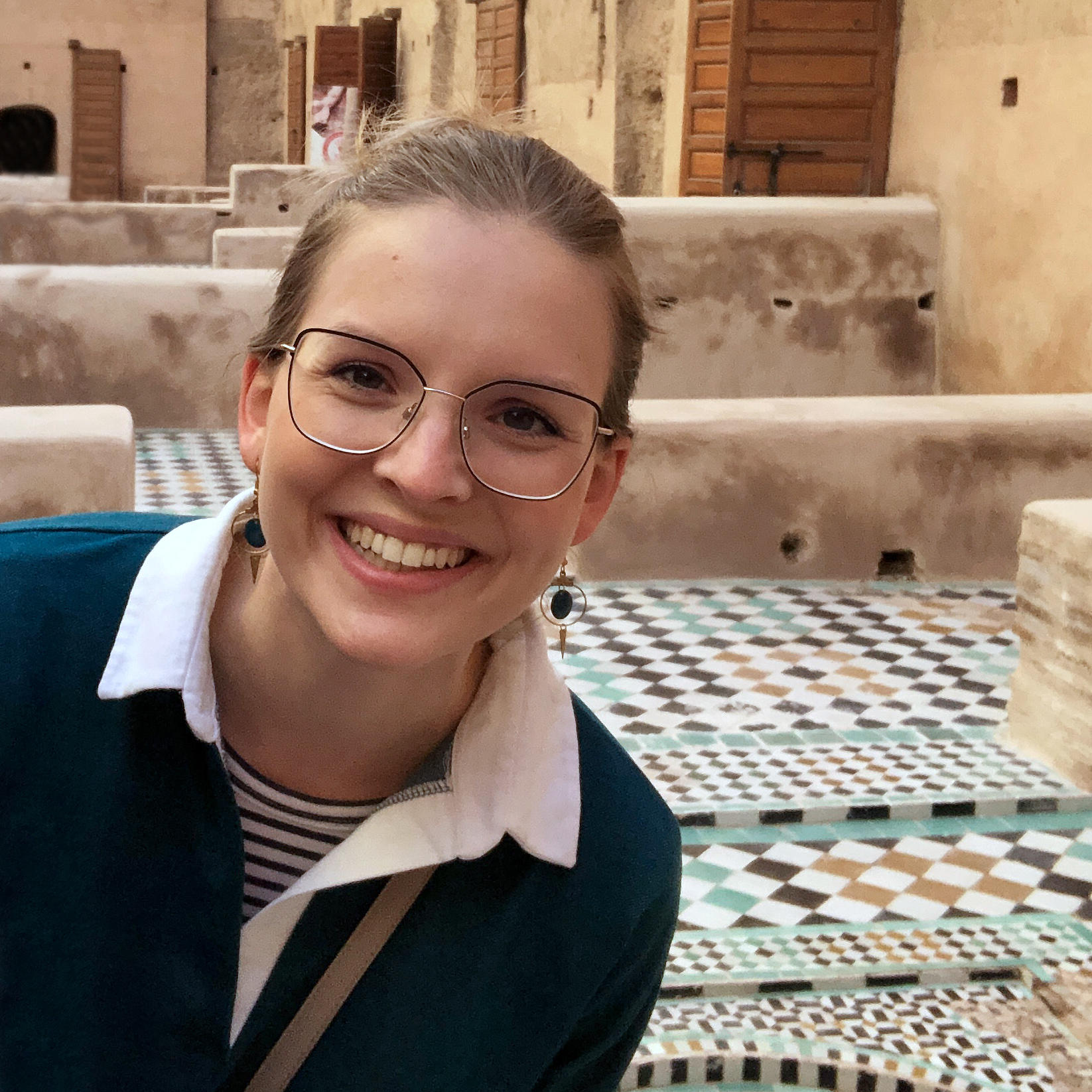Du bist jetzt seit einer Weile in Deutschland, hast vielleicht schon einen Deutsch Kurs online gemacht? Wenn Du Dich mit Einheimischen wirklich unterhalten willst, wirst Du Deine Fähigkeiten ausbauen müssen. Bevor Du Dich eingehend mit den Themen der Welt befassen kannst, musst Du erst mal lernen, ein Gespräch führen.
Dazu solltest Du wissen, wie Du einen Grundsatz auf Deutsch strukturierst. Ein Satz im Deutschen folgt einer einfachen Logik:
Subjekt
Prädikat
Objekt
Für einen Deutschlernenden ist die Satzstruktur oder Wortfolge oft undurchsichtig, da sie auf Deutsch aufgrund der verschiedenen grammatikalischen Fälle flexibler ist als in vielen anderen Sprachen. Die gute Nachricht ist allerdings, dass die deutsche Satzstruktur einem klaren Regelwerk folgt. Wir zeigen dir, worauf Du achten musst.

Klare Satzstruktur
Ein regulärer deutscher Satz folgt meist dem Schema: Subjekt – Prädikat – Objekt. Bei der Wortreihenfolge einfacher Aussagen, steht das Subjekt also an erster Stelle, das Verb an zweiter Stelle und alle anderen Elemente an dritter Stelle.
Ein einfacher Beispielsatz: "Ich liebe dich." oder "Er arbeitet zu Hause."

Das "Dich" im Beispielsatz ist übrigens ein Pronomen im Deutschen.
Aber was genau bedeuten die Begriffe eigentlich? Wir erklären es dir:
- Subjekt: Das Subjekt ist der Satzbestandteil, der die Person, das Tier oder die Sache bezeichnet, über die im Satz etwas ausgesagt wird. Es steht meist am Anfang des Satzes und wird vom Prädikat regiert.
- Prädikat: Das Prädikat ist der Satzbestandteil, der angibt, was das Subjekt tut, erleidet oder ist. Es besteht aus einem Verb oder einer Verbphrase und kann weitere Satzglieder wie Objekte oder Adverbiale enthalten.
- Objekt: Das Objekt ist ein Satzglied, das die vom Verb ausgedrückte Handlung betrifft oder auf das sich die Handlung des Verbs bezieht. Es kann direktes Objekt (Akkusativobjekt) oder indirektes Objekt (Dativobjekt) sein und steht normalerweise nach dem Prädikat.
Möchtest du mehr über deutsche Artikel erfahren?
Besonderheiten von Verben
Es gibt einige Besonderheiten, wenn wir uns die Verben, also das Prädikat anschauen. Wir zeigen dir, worauf du achten musst.
Verben immer als zweites Element
Egal welches Element einen deutschen deklarativen Satz (also eine Aussage) beginnt, das Verb ist immer das zweite Element.
Auch wenn Du mal alles andere über die deutsche Wortreihenfolge vergessen haben solltest, denke immer daran: Das Subjekt steht entweder an erster Stelle oder unmittelbar nach dem Verb, wenn das Subjekt nicht das erste Element des Satzes ist.
Dies ist eine einfache, leicht zu merkende und sehr hilfreiche Regel: In einer Aussage steht das Verb immer an zweiter Stelle. Bei zusammengesetzten Verben steht der zweite Teil des Verbs immer am Satzende, der konjugierte Teil ist jedoch immer noch an zweiter Stelle.

"An zweiter Stelle" bedeutet übrigens das zweite Element, nicht unbedingt das zweite Wort. Zum Beispiel besteht im folgenden Satz das Subjekt (das kleine Mädchen) aus drei Wörtern und das Verb (geht) kommt an zweiter Stelle, aber es ist das vierte Wort: "Das kleine Mädchen geht in die Schule."
Weisst du, was Adverbien im Deutschen sind?
Diese Regel gilt für alle Sätze, die unabhängig sind.
Eine Ausnahme von dieser Regel sind Interjektionen, Ausrufe, Namen und bestimmte Adverbialsätze, die normalerweise durch ein Komma getrennt sind. Hier sind einige Beispiele:
- "Nein, das kleine Mädchen geht heute nicht in die Schule."
- "Lisa, es wird heute nicht regnen."
- "Wie gesagt, das kann ich heute nicht mehr schaffen"
Bei Fragen steht das Prädikat in der Regel zu Beginn. Wird die Frage mit einem Fragewort eingeleitet, steht das Prädikat nach dem Fragewort. Fragewörter sind unter anderem:
warum
wann
wie
Eine weitere Ausnahme betrifft abhängige Sätze oder Nebensätze. In Nebensätzen steht das Verb immer an letzter Stelle.
Zusammengesetzte Verben
Bei zusammengesetzten Verben steht der zweite Teil der Verbalphrase (Partizip Perfekt, trennbares Präfix, Infinitiv) an letzter Stelle, aber das konjugierte Element ist immer noch das zweite:
- "Das kleine Mädchen kommt in der Schule an."
- "Das kleine Mädchen wird heute in die Schule gehen."
Das sind wichtige Konzepte in der deutschen Grammatik.
Deutsche Sätze beginnen jedoch oft mit etwas anderem als dem Subjekt, normalerweise aus stilistischen Gründen.
Dem Verb kann nur ein Element vorangehen, es kann jedoch aus mehr als einem Wort bestehen. In solchen Fällen bleibt das Verb an zweiter Stelle und das Subjekt muss dem Verb unmittelbar folgen:
- "Jetzt kommt das kleine Mädchen nach Hause."
- "Vor zwei Tagen ist sie gar nicht in die Schule gegangen."
Modalverben
Im Deutschen gibt es viele Gründe, warum ein Verb unbedingt am Ende des Satzes stehen muss. Einer dieser Gründe sind die sogenannten Modalverben.
Modalverben sind Verben, die eine Modalität ausdrücken, wie Möglichkeit, Notwendigkeit, Erlaubnis oder Wunsch. Sie modifizieren die Bedeutung des Hauptverbs und werden verwendet, um den Modus oder die Art und Weise der Handlung oder des Geschehens im Satz zu kennzeichnen.
Im Deutschen ist der Infinitiv des Verbs normalerweise leicht zu erkennen. Es gibt einige wie "sammeln" und "segeln", die etwas anders sind, aber die meisten enden auf -en: "Laufen", "gehen", "sagen", "singen", "lieben", "führen" und so weiter.
Das kann für dich sehr wichtig sein für den Deutschkurs Zürich.
Modalverben sind eine sehr häufige Art sogenannter Hilfsverben:
- müssen
- können
- sollen
- wollen
Wenn Du ein Modalverb verwendest, befindet sich das zweite Verb des Satzes immer im Infinitiv und steht am Ende des Satzes. Es wird sich zunächst vielleicht unnatürlich anfühlen, das Infinitiv ans Ende des Satzes zu setzen, aber so ist es nun mal: "Müssen wir wirklich auf diese langweilige Party gehen?"
Nebensätze im Deutschen
Nebensätze, die Teile eines Satzes, die nicht allein stehen können und von einem anderen Teil des Satzes abhängig sind, bedeuten häufig etwas kompliziertere Regeln für die Wortreihenfolge.
Ein Nebensatz wird durch eine untergeordnete Konjunktion (dass, ob, weil, wenn) oder bei Relativsätzen durch ein Relativpronomen (den, der, die, welche) eingeführt. Das konjugierte Verb steht am Ende eines Nebensatzes.

Hier einige Beispiele für deutsche Nebensätze:
- „Ich weis nicht, wann die Schule morgen anfängt.”
- "Als ich rausging, bemerkte ich sofort die klirrende Kälte." ("klirrend" ist ein deutsches Adjektiv; erfahre auch mehr zu dieser Wortart!
- „Es gibt eine Umleitung, weil die Strasse repariert wird."
- "Das ist der Hund, den wir gestern gesehen haben."
Veränderte Reihenfolge
Grundsätzliche gilt eine andere Reihenfolge: Nebensatz zuerst, Verb zuletzt.
Der Nebensatz wird immer durch ein Komma vom Hauptsatz getrennt, unabhängig davon, ob es vor oder nach dem Hauptsatz steht. Die anderen Satzelemente wie Zeit, Art und Ort fallen in die normale Reihenfolge.
Das einzige, woran Du denken musst, ist, dass wenn ein Satz wie im zweiten Beispiel oben mit einem Nebensatz beginnt, das allererste Wort nach dem Komma vor dem Hauptsatz das Verb sein muss. Im obigen Beispiel war das Verb "bemerkte" das erste Wort.
Eine andere Art von Nebensatz ist der Relativsatz, der durch ein Relativpronomen eingeführt wird. Relativsätze und Nebensätze haben dieselbe Wortreihenfolge. Das letzte Beispiel in den obigen Sätzen ist eigentlich eine Relativklausel. Ein Relativsatz erklärt oder identifiziert eine Person oder Sache im Hauptsatz weiter.
Wie Du siehst, endet ein Nebensatz immer mit dem konjugierten Verb.
Besondere Relativsätze
Ein Relativsatz steht immer im Verhältnis oder im Bezug zu einer Sache, die im Hauptsatz angekündigt wird. Ein Relativsatz ist also ein eingeleiteter Nebensatz. Wenn ein Relativsatz zwei Verben enthält, ist das Verb, das ganz am Ende des Satzes steht, immer im zweiten Teil des Satzes. Das erste Verb bleibt in seiner normalen Position.
Im Deutschen steht das Verb in jedem Nebensatz am Ende:
- Es kommt auch mein Freund, der so lustig ist.
- Das ist das Buch, das ich am besten finde.
- Ich finde es hilfreich, wenn wir zusammen lernen.
- Ich möchte nur Mitarbeiter in meinem Café haben, die richtig guten Kaffee machen können.
Das einleitende Wort kann entweder ein Relativpronomen (der, die, das) oder ein Relativadverb sein (wenn, wo, wohin).
Brauchst du einen Deutschkurs Basel?
Untergeordnete und koordinierende Konjunktionen
Es gibt verschiedene Arten von Konjunktionen, die unterschiedliche Auswirkungen auf den Satz haben. Grundsätzlich verbinden Konjunktionen verschiedene Satzteile. Wir stellen dir die beiden unterschiedlichen Arten vor.
Untergeordnete Konjunktionen
Ein wichtiger Aspekt der Nebensätze sind die sogenannten unterordneten oder auch subordinierenden Konjunktionen. Unterordnende Konjunktionen haben die Aufgabe, einen Hauptsatz mit einem Nebensatz zu verbinden.

Dabei bewirken sie etwas Verwirrenderes: Sie setzen das erste Verb des Satzes an das Ende des Satzes. Für alle aufgeführten unterordneden Konjunktionen muss das konjugierte Verb also am Ende des von ihnen eingeführten Satzteils stehen.
Einige der unterordneden Konjunktionen ("bis", "seit", "während"), können mit ihrer zweiten Identität als Präpositionen im Deutschen verwechselt werden, aber dies ist normalerweise kein grosses Problem.
Das Wort "als" wird auch in Vergleichen verwendet, wie in "grösser als". In diesem Fall handelt es sich nicht um eine unterordnende Konjunktion. Wie immer muss man sich den Kontext ansehen, in dem ein Wort in einem Satz vorkommt.
Die häufigsten subordinierenden Konjunktionen sind:
während
bis
als
wenn
da
weil
ob
obwohl
dass
bevor
damit
ehe
falls
indem
nachdem
obgleich
obschon
seit/seitdem
sobald
sodass / so dass
solang(e)
trotzdem
wenn
Einige Beispiele zur Verwendung in Sätzen:
- Ich mag ihn nicht, weil er so ein blöder Angeber ist.
- Ruf mich bitte an, sobald Du zu Hause bist.
- Ich frühstücke, bevor ich in die Schule gehe.
Hinweis: Alle Fragewörter (wann, wer, wie, wo) können ebenfalls als unterordnende Konjunktionen verwendet werden:
- Ich weiss nicht, wann er nach Hause kommt.
- Ich habe nicht gesehen, wer das war.
- Woher weisst Du, wie ich mich fühle?
- Hast Du ihr gesagt, wo Du wohnst?
Kennst schon viele deutsche Substantive?
Es bleibt dem armen Leser nichts anderes übrig, als sich zum weit entfernten Verb durchzuschlagen, so gut er eben kann. Eine andere Technik, die unterordnenden Konjunktionen zu lernen, besteht darin, diejenigen zu lernen, die NICHT untergeordnet sind, da es erheblich weniger davon gibt.
Koordinierende Konjunktionen
Koordinierende Konjunktionen verbinden etwa zwei Hauptsätze bzw. gleichrangige Sätze miteinander. Sie haben keinerlei Einfluss auf die Wortreihenfolge. Die koordinierenden Konjunktionen (mit normaler Wortreihenfolge) sind:
aber
denn
entweder...oder
weder...noch
und
Einige Beispielssätze sind:
- Ich laufe los und werfe den Ball.
- Ich kann nicht gut sprechen, aber ich verstehe ziemlich gut.
- Entweder gehe ich jetzt nach Hause, oder ich trinke noch einen Kaffee.
- Ich bin müde, denn ich habe letzte Nacht nicht viel geschlafen.
So, jetzt sind wir fertig! Du bist jetzt fit im deutschen Satzbau und kannst Dich den verschiedenen Zeitformen im Deutschen widmen!
Das Wichtigste ist, dass Du so viel wie möglich Deutsch hörst, liest und sprichst, dann machst Du es bald von ganz alleine richtig.
Mit KI zusammenfassen: